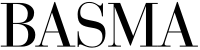Kommentar über den bewussten und unbewussten Umgang mit schwarzen Muslimen
Zuerst veröffentlicht am 4. Dezember 2017 auf www.islamische-zeitung.de . Von Tijana Sarac.
Foto: Khalil Mitchell for Visualorum
(iz). Wird im muslimischen Diskurs das Thema Rassismus behandelt, geht es meist um Islamfeindlichkeit, die aus den Muslimen eine homogene Gruppe – Rasse – macht, welche als Feindbild fungiert. Ein Blick nach innen dürfte uns aber eine andere Dimension des Phänomens Rassismus und unseres eigenen Zustands eröffnen. Denn ein Thema, über welches nur ungern gesprochen wird, ist der Rassismus unter Muslimen selbst. Verständlich, denn der Blick in den Spiegel kann äußerst unangenehm sein. Die Behauptung, Rassismus und Nationalismus hätten im Islam keinen Platz, stimmt zwar, aber dies beschreibt nur, was Allah und Sein Gesandter, Allahs Segen und Frieden auf ihm, uns lehren, nicht etwa, wie wir diese Lehre in die Tat umsetzen.
Das aktuellste Beispiel hierfür ist der Sklavenhandel schwarzafrikanischer Migranten in Libyen. Schwarze Muslime beklagen zu Recht, dass ihrem Leid eine andere, geringere Beachtung geschenkt wird als etwa jenem der Syrer oder Palästinenser. Der Verkauf von Menschen und ihre Haltung als moderne Sklaven in Teilen der arabischen Welt ist nichts Neues. Für echte Aufregung sorgt das jedoch nie, es sei denn, ein unausweichlicher Medienbericht zwingt uns zu ein paar Hashtags und Entrüstung über diese Praktiken, die mit Islam natürlich nichts zu tun haben.
Wenn man das Thema aber damit abtut und verkennt, dass kulturelle Überzeugungen in arabischen, pakistanischen, iranischen, türkischen oder europäischen Traditionen nun mal rassistisch sein können und von Muslimen trotz ihres Islam weiterhin praktiziert werden können und de facto praktiziert werden, begibt man sich schlichtweg in eine konstruierte muslimische Märchenwelt.
Nun würden einige entgegnen, dass es unter Muslimen doch Normalität sei, dass sich Menschen unterschiedlicher Herkünfte zusammentäten und ethnisch gemischte Gemeinschaften und Ehen nicht die Ausnahme seien. Das stimmt. In Deutschland wird es für einen Bosniaken und eine Türkin mit Sicherheit immer leichter, zu heiraten. Auch für einen Marokkaner und eine Deutsche. Man ist empfänglicher für die Kultur der Anderen und sieht sich oft unter der Einheit des Islam vereint. Das ist, was zählt.
Für schwarze Muslime gilt diese Entwicklung in den meisten Fällen jedoch nicht. Denn die muslimische Welt ist von einem eklatanten Rassismus gegenüber „den Afrikanern“ ebenso betroffen, wie alle anderen auch. Schaut man sich einmal an, wie etwa nicht-schwarze muslimische Familien darauf reagieren, wenn die eigene Tochter einen schwarzen Muslim heiraten möchte, sieht man, wie schnell es nicht mehr um Wissen im Din und guten Charakter geht, sondern um „nicht gut genug“, „man sollte sich nicht mischen“, „wir wollen keine schwarzen Enkelkinder“, und vor allem um „was werden die Leute sagen“. Es gibt muslimische Völker, die sich als besonders zivilisatorisch überlegen ansehen und deswegen auf Schwarzafrikaner herabschauen. Es gibt auch schlichtweg die Ansicht, es gebe „die“ schwarze Kultur oder Charaktereigenschaften, wie etwa, dass „der schwarze Mann“ gefährlich und gewaltbereit sei oder „die Schwarzen“ ungebildet und arm seien.
Oft sprechen wir vom Rassismus „der Weißen“ und dass dieser ein Konstrukt der westlichen Kolonialisten sei. Aber die Tatsache, dass viele sich für ungemein islamisch ausgereift halten und gleichzeitig unverhohlen rassistisch sein können, deutet auf eine Krankheit des Geistes hin, die man nicht einfach abtun kann mit „das kommt vom Westen“. Wenn es dieses Phänomen unter Muslimen gibt, dann müssen wir uns mit uns selbst beschäftigen und mit den Vorstellungen, die wir gegenüber Schwarzen hegen. Ein mythisches Überlegenheitsdenken der „eigenen“ Zivilisation ist ironischerweise ein globales Phänomen. Wenn man es nicht schafft, dieses Denken durch die islamische Praxis in der eigenen Gemeinschaft aufzulösen, aber sich über den antimuslimischen Rassismus der Mehrheitsgesellschaft beklagt, dann grenzt dies an Heuchelei.
Wir sind weit davon entfernt, dass etwa arabisch-, türkisch- oder bosnischstämmige Muslime sich in Deutschland von einem schwarzen Imam im Gebet führen lassen, oder überhaupt ein Redner eingeladen wird, der sie über die afrikanisch-islamischen Schätze der Spiritualität und Gelehrsamkeit unterrichtet. Ob wir es zugeben wollen oder nicht, wir schauen auf Afrika meist mit einem zivilisatorisch überheblichen Blick. Sehen wir in einem Video schwarze Hadschis vor Freude tanzen und Segenswünsche auf den Propheten singen, als sie in Medina ankommen, dann wird es meist entweder als Übertreibung oder als „süß“ kommentiert. Beides zeugt von Unwissen und Arroganz, denn ihr Ausdruck der Liebe zum Propheten ist der menschlichen Natur (Fitra) weitaus näher als so manch rigider nahöstlicher Zeitgenosse, der beim geringsten Hüftschwung einer Frau schon das Tor zur Unsitte geöffnet sieht. Ebenso ist die Art und Weise, wie Islam seit Jahrhunderten in Afrika gelebt wird, nicht „süß“. Sie ist tief verwurzelt in Wissen und dementsprechendem Handeln sowie reich an erhabener Geschichte, die wir studieren sollten, wenn wir uns selbst verstehen wollen.
Wir können nicht von einer gesunden Gemeinschaft ausgehen, wenn wir überrascht sind, wenn schwarze Muslime den Qur’an auswendig rezitieren können, wenn sie aus Gelehrtenfamilien stammen, wir uns aber von ihnen nichts über unseren Din erklären lassen wollen. Wenn wir meinen, ihre Kleidung sei nicht „islamisch genug“, weil sie bunter ist oder die Kopftücher anders gebunden werden. Ebenso können wir nicht von einem wirklichen Miteinander sprechen, wenn wir mit zwar wohlwollenden („die sind einfach cool“) aber dennoch erniedrigenden Blick „die Schwarzen“ als eine homogene ethnische Gruppe ansehen und ihre Vielfalt uns letztlich egal ist.
Das Mindeste am Islam einer Person müsste sein, dass der Rassismus aus ihr verschwindet. Befassen wir uns eingehend mit dem islamischen Erbe, welches wir weitertragen wollen, ist dies unabdingbar und kann zu einer realen Transformation unserer Gesellschaft führen, wenn wir endlich als Vorbild für die natürliche Vermischung verschiedener Kulturen und Hautfarben dienen. Wir sollten uns nicht in unserer Vorstellung einer „idealen Umma“ einreden, dass gesellschaftliche Probleme „bei uns“ keinen Platz hätten, sondern eher daran arbeiten, die Sunna auf die Art wiederzubeleben, dass wir tatsächliche Lösungen für die Schöpfung bringen und aus dieser Liebe zum Schöpfer der Weg für uns und die Suchenden klar wird.